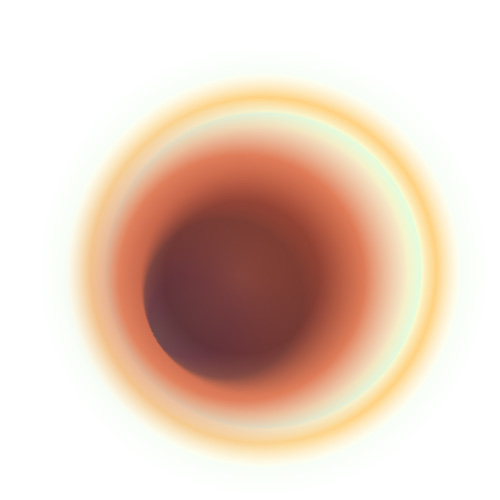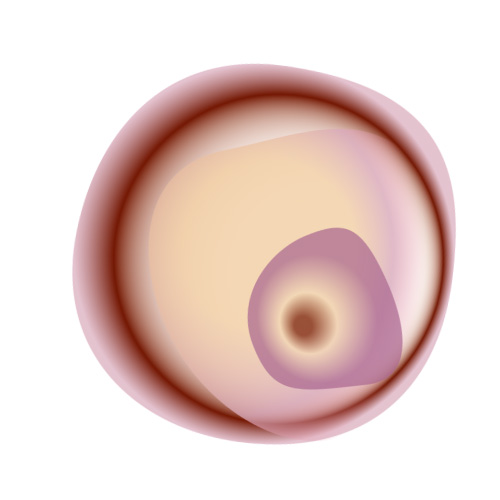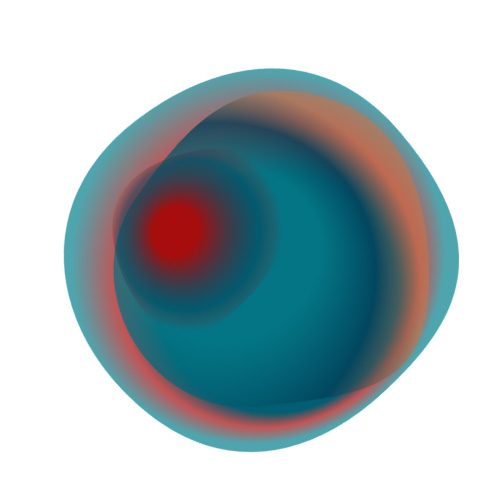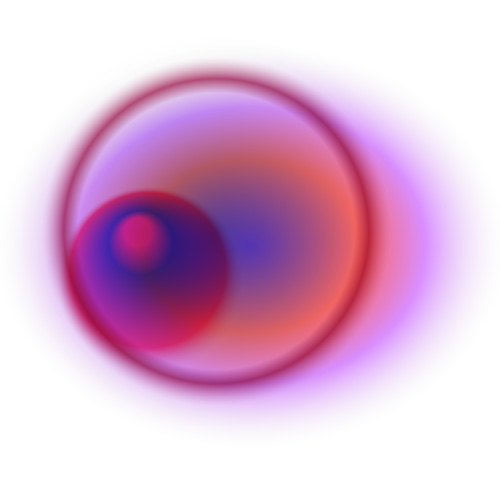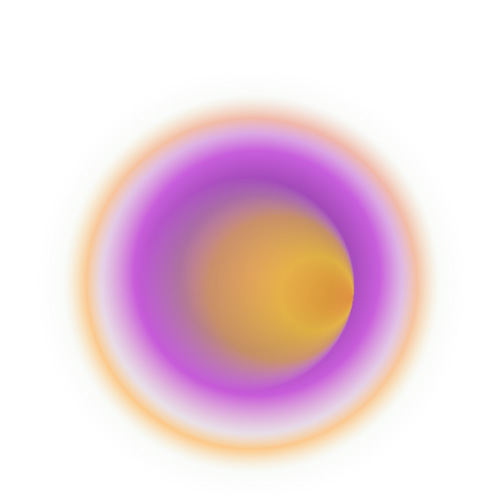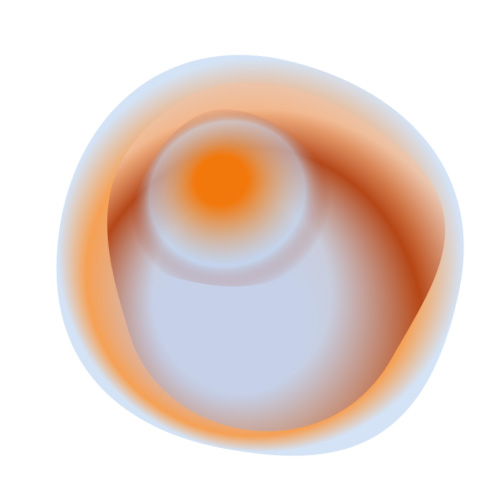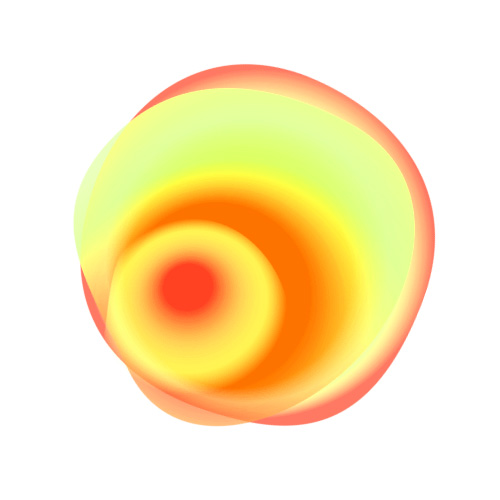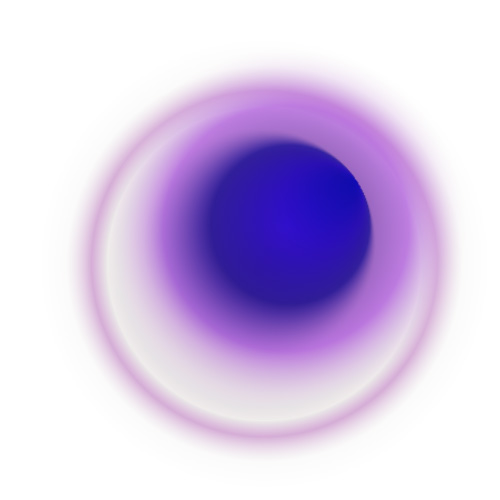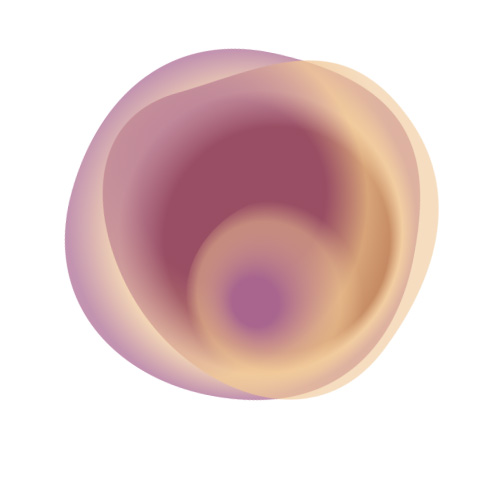Andreas von der Heydt, die aktuelle Gemengelage aus Rezession, Unsicherheit und Transformationsdruck wirkt auf viele Menschen geradezu erdrückend. Sie sprechen im Rahmen Ihrer Coachings ja sehr viel mit Führungskräften in den Unternehmen. Inwieweit wirkt sich der gestiegene Druck auf die Organisationen aus?
Was ich in meiner Coaching- und Beratungsarbeit mit Führungskräften weltweit, und unabhängig von Branche und Unternehmensgröße, zunehmend erlebe, ist nicht einfach nur „mehr Druck“. Es ist häufig eine toxische Kombination: Organisationen und Führungskräfte sollen gleichzeitig super innovativ UND hochgradig kosteneffizient sein, radikal transformieren UND Sicherheit bieten, permanent agil sein UND Ruhe ausstrahlen. Dieser Druck führt nicht zu mehr Klarheit, sondern zu einer Art organisationaler Dissoziation.
Was heißt das?
Die oberen Führungsebenen flüchten sich in strategische Schönmalerei gepaart mit vagen Hochglanzpräsentationen, während die mittleren Ebenen in permanenter Ausführungshektik versinken, ohne dass beide Welten noch wirklich verbunden sind. Was in der Organisationspsychologie als „Sense-Making“ bezeichnet wird, also die gemeinsame Bedeutungskonstruktion dessen, was gerade passiert, findet schlicht nicht mehr statt.
Man lebt sich sozusagen auseinander?
In vielen Organisationen entstehen derzeit das, was ich „emotionale Schulden“ nenne: Ungeklärte Konflikte, nicht verarbeitete Verluste, aufgestaute Frustrationen. Ein Vorstand eines Technologieunternehmens erzählte mir kürzlich im Rahmen unserer Coaching-Sitzung, wie effizient sein Team die zweite Restrukturierung in 18 Monaten umgesetzt hat. Als ich fragte: „Und wann haben Sie mit Ihrem Team über das gesprochen, was diese permanenten Veränderungen mit den Menschen machen?“, herrschte langes Schweigen. Seine Antwort: „Dafür ist gerade keine Zeit.“ Damit fing unsere eigentliche Coaching-Arbeit an.
Vielleicht war dem Manager auch egal, wie es den Mitarbeitenden geht.
Die Krux ist, dass Organisationen und Führungskräfte meinen, sich emotionale Reflexion nicht leisten zu können. Dabei ist genau deren Fehlen der Grund, warum Transformationen scheitern, Leistungsträger gehen und Innovation stockt. Die Forschung zu psychologischer Sicherheit zeigt eindeutig, dass Teams, die über ihre Emotionen und Unsicherheiten sprechen können, und einen entsprechenden Rahmen für offene und unterstützende Zusammenarbeit etablieren, nicht nur resilienter sind, sondern auch produktiver und innovativer. Stattdessen neigen Manager unter Druck zu verschärfter Kontrolle. Man misst immer mehr, kontrolliert immer engmaschiger und verliert dabei den Blick für das große Ganze. In Wahrheit brauchen Organisationen jetzt das Gegenteil. Nämlich mehr Vertrauen, mehr Delegationsfähigkeit, mehr Ambiguitätstoleranz.
„Am meisten beunruhigt mich die Einsamkeit in Führungspositionen. Viele haben niemanden für offene Gespräche über Zweifel. Diese Isolation verstärkt alles andere.“
Wo schnell Ergebnisse hermüssen, ist das natürlich leichter gesagt als getan.
Klar. Es bedeutet die eigene Unsicherheit auszuhalten statt zu verdrängen. Die zentrale Leadership-Herausforderung unserer Zeit ist, dass Führungskräfte lernen müssen, nicht mehr die zu sein, die alle Antworten haben, sondern die, die die besten Fragen stellen und Räume schaffen, in denen Unsicherheit benannt werden darf, ohne als Schwäche zu gelten. Viele Organisationen leiden nicht unter zu wenig Strategie oder Digitalisierung, sondern unter einem fundamentalen Mangel an psychologischer Sicherheit und kritischer Selbstreflexion auf Führungsebene. Die eigentliche Transformation ist keine digitale, sie ist eine zutiefst menschliche.
Welche Faktoren empfinden Sie derzeit als am stärksten belastend für Unternehmen und Führungskräfte?
Da wirken mehrere Dynamiken zusammen. An erster Stelle steht paradoxerweise nicht die Unsicherheit selbst, sondern die fehlende Erlaubnis, Unsicherheit zuzugeben. Führungskräfte müssen Antworten liefern, während niemand wirklich weiß, wie die Märkte in sechs Monaten aussehen. Diese erzwungene Scheinsicherheit ist emotional zehrend. Der zweite Faktor ist die Geschwindigkeit der Mehrfachveränderung. Ein CEO sagte mir kürzlich: „Heute starten wir die fünfte Initiative, bevor die erste richtig greift.“ Diese permanente Gleichzeitigkeit macht strategisches Denken nahezu unmöglich. Dazu kommt die Polarisierung der Belegschaften. Führungskräfte müssen extreme Gegensätze managen: Flexibilität versus Struktur, Purpose versus Sicherheit, KI-Begeisterung versus Existenzängste. Das erfordert emotionale Intelligenz, auf die viele nicht vorbereitet wurden. Am meisten beunruhigt mich jedoch die Einsamkeit in Führungspositionen. Viele haben niemanden für offene Gespräche über Zweifel. Diese Isolation verstärkt alles andere. Das Entscheidende ist, dass all diese Faktoren zur neuen Normalität geworden sind. Daher müssen wir grundlegend überdenken, wie wir führen, ohne dabei unsere Gestaltungsfähigkeit zu verlieren.
Was bedeutet dann Führung in Zeiten multipler Krisen?
Das lässt sich leider nicht in simplen Rezepten zusammenfassen… Aber es gibt klare Muster, die ich immer wieder beobachte, sowohl destruktive als auch konstruktive. Der häufigste und gefährlichste Fehler ist das, was man als „Aktivismus-Falle“ bezeichnen kann. Führungskräfte verfallen in hektischen Aktionismus. Noch ein Workshop, noch eine Task Force, noch eine Reorganisation. Sie verwechseln Bewegung mit Fortschritt. Dahinter steckt oft die eigene Angst, als untätig oder führungsschwach wahrgenommen zu werden. Aber diese permanente Umtriebigkeit erschöpft Teams und zerstört Vertrauen.
Welche anderen „Fallen“ gibt es?
Es gibt in anspruchsvollen Führungssituationen die Tendenz zur emotionalen Sterilität. Führungskräfte ziehen sich auf Zahlen, Daten, Fakten zurück und blenden die menschliche Dimension komplett aus. Sie sprechen dann primär über Effizienzsteigerungen, aber nicht über den Wert und das Potential ihrer Teams. Das Paradoxe ist, dass Menschen gerade in Krisen nicht nur rationale, sondern vor allem emotionale Orientierung brauchen. Und schließlich ist selektive Transparenz ein anderer typischer Fehler in Krisenzeiten. Führungskräfte teilen dann oftmals nur die „guten“ Informationen und halten vermeintlich Belastendes zurück, um das Team zu schonen. Dabei unterschätzen sie massiv die Intelligenz ihrer Mitarbeitenden. Menschen spüren, wenn etwas verschwiegen wird, und in diesem Informationsvakuum gedeihen Gerüchte und Misstrauen. Teilwahrheiten sind toxischer als unbequeme Wahrheiten.
„Die besten Führungskräfte in Krisen sind nicht die, die am meisten tun, sondern die, die den Mut haben, Dinge bewusst nicht zu tun. Sie reduzieren Komplexität, schaffen Fokus und schützen ihre Teams vor Überforderung.“
Was also tun?
Führung in Krisen erfordert vor allem drei Dinge: Erstens, Klarheit in der Haltung, nicht in den Antworten. Es geht nicht darum, alle Lösungen zu haben, sondern klar zu kommunizieren, wofür man steht, welche Prinzipien die Entscheidungen leiten und dass man auch durch Unsicherheit navigieren wird. Wie man es beispielsweise als Führungskraft formulieren sollte: „Ich kann euch nicht sagen, wo wir in zwei Jahren stehen. Aber ich kann euch sagen, wie wir dort hinkommen wollen und dass wir das gemeinsam umsetzen werden.“ Zweitens geht es um radikale Priorisierung statt Addition. Die besten Führungskräfte in Krisen sind nicht die, die am meisten tun, sondern die, die den Mut haben, Dinge bewusst nicht zu tun. Sie reduzieren Komplexität, schaffen Fokus und schützen ihre Teams vor der Überforderung durch Gleichzeitigkeit. Das bedeutet auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und Projekte zu stoppen.
Und drittens?
Präsenz und Nahbarkeit. In Krisen brauchen Menschen ihre Führungskräfte sichtbar, ansprechbar, echt. Nicht perfekt, nicht unerschütterlich, sondern authentisch. Die stärksten Momente in meinen Coachings sind oft die, in denen Führungskräfte lernen zu sagen: „Auch ich weiß nicht genau, wie das ausgeht, aber ich bin hier, und ich gehe das mit meinem Team gemeinsam an.“ Eine klare, ehrliche Kommunikation schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist gerade in schwierigen Zeiten die Währung, die trägt. Menschen können mit harten Wahrheiten umgehen, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie ernst nimmt und nicht im Dunkeln stehen lässt.
Führungskräfte sind trotzdem auch nur Menschen, und man muss davon ausgehen, dass die gegenwärtige Polykrise vielen Managern genauso aufs Gemüt schlägt wie Ihren Mitarbeitenden. Wie hält man die Motivation des Teams hoch, wenn man selbst den Druck spürt?
Auch in der schwierigsten Situation können wir steuern, worauf wir den Fokus legen. Es geht nicht um Schönreden, sondern um bewusst gestalten: Welche kleinen Fortschritte haben wir gemacht? Wo haben wir als Team zusammengehalten? Was können wir konkret beeinflussen, auch wenn vieles außerhalb unserer Kontrolle liegt? Als Führungskraft muss ich selbst vorleben, dass ich nicht im Krisenmodus erstarre, sondern handlungsfähig bleibe. Das bedeutet, ich erkenne die Realität an, und ich zeige Wege auf. Ich sorge für Orientierung durch klare Prioritäten. Ich feiere Zwischenerfolge, auch wenn sie klein sind. Und ich schaffe Räume, in denen das Team auch mal Frust ablassen kann, ohne dass daraus Resignation wird. Motivation kommt letztlich aus dem Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wenn Menschen erleben, dass ihr Handeln Wirkung hat, und sei es in einem kleinen Bereich, dann bleiben sie im Spiel. Die Aufgabe als Führungskraft ist es, genau diese Erfahrungen zu ermöglichen und sichtbar zu machen.
Hilft der Verweis darauf, Krisen auch als Chance zu begreifen, weiter? Wie sehen Sie das?
Der Satz „Lasst uns die Krise als Chance nutzen“ ist für viele Menschen zur Plattitüde geworden, weil er im falschen Moment wie eine Verharmlosung rüberkommen kann. Gleichzeitig beobachte ich, dass wir uns in Europa gerne dahinter verstecken, diese Haltung grundsätzlich abzulehnen. In den USA oder vielen asiatischen Ländern gehen Menschen deutlich pragmatischer mit Krisen um. Denn es stimmt ja, dass Krisen uns zwingen, Dinge zu hinterfragen und anders zu machen. Sie schaffen Spielräume für Veränderungen, die vorher undenkbar schienen. Die Frage für Führungskräfte ist nur, wann und wie spreche ich das an?
Und Ihre Antwort?
Ein bewährter Ansatz ist, erst die Realität würdigen, dann die Perspektive öffnen. Wenn das Team erschöpft ist, braucht es keine Chancen-Rhetorik, sondern Entlastung und Orientierung. Wenn es aber Momente gibt, wo durchgeatmet werden kann, dann sollten Führungskräfte fragen, was haben wir gelernt, was machen wir jetzt anders, was wollen wir beibehalten und wo gibt es neue und bessere Möglichkeiten für uns? Es geht also darum, bewusst nach Lerneffekten und Wachstumsmöglichkeiten zu suchen. Genau das ist der Kern dessen, was der Satz meint, wenn man ihn richtig lebt.
„Eine Krise zwingt zur Klarheit, aber sie kann auch Identität neu formen.“
Wo stecken in einer Rezession aus Ihrer Sicht tatsächlich Chancen?
Wenn Märkte einbrechen und Budgets schrumpfen, fällt der Schleier. Man erkennt dann, was wirklich trägt, was lähmt, was längst überfällig ist. Prozesse, die sich eingeschlichen haben, Projekte ohne echten Wert, Strukturen, die niemand braucht. Es ist der Moment, alte Zöpfe abzuschneiden, Verkrustungen aufzubrechen und radikale Veränderungen umzusetzen, die in guten Zeiten am Widerstand gescheitert wären. Gleichzeitig entstehen plötzlich Möglichkeiten, die vorher undenkbar waren. Top-Talente werden verfügbar, gute Köpfe suchen neue Herausforderungen. Wer jetzt umsichtig und zielstrebig in Menschen und Ideen investiert, baut den Vorsprung für das nächste Kapitel auf. Eine Krise zwingt zur Klarheit, aber sie kann auch Identität neu formen. Es ist die Chance, Mission, Purpose und Werte zu erneuern, Teams neu zu entfachen und das Wir-Gefühl zu stärken. Der gemeinsame Spirit „Jetzt erst recht“ kann mehr Energie freisetzen als jedes Innovations-Projekt.
Sie sprechen von „High-Impact Leadership“ als ein richtungsweisender Ansatz, um Zukunft erfolgreich zu gestalten. Was heißt das für Sie? Zielt Leadership nicht immer auf „high impact“, also möglichst große Wirkung ab?
Auf den ersten Blick würde man tatsächlich denken, Führung sollte immer auf maximale Wirkung abzielen. Aber seien wir ehrlich. Das tut sie nicht. Das von mir entwickelte Konzept von High-Impact Leadership bedeutet, dass Top Organisationen und Führungskräfte gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, in drei Dimensionen transformative und nachhaltige Wirkung erzielen.
Welche sind das?
Die erste Dimension ist die professionelle Dimension, das „Was“ von Führung. Hier geht es darum, einen möglichst hohen Wirkungsgrad bei allem, was quantitativ und qualitativ messbar ist, zu generieren: Umsatz, Gewinn, Wachstumsraten, Marktanteile, erfolgreiche Produktlaunches etc. Das klassische Geschäft eben. Bei der zweiten Dimension, der persönlichen Dimension, dem „Wer“ von Führung, sprechen wir über maximale Wirkung, die aus Beziehungen, echter Zusammenarbeit und tiefgehenden Partnerschaften gewonnen wird. Darum, Mitarbeitende zu entwickeln, gemeinsam als Menschen zu wachsen, zu lernen, besser zu werden. Sich selbst und andere wirkungsvoller zu führen. Das wird schon deutlich seltener fundiert und systematisch angegangen. In der dritten Dimension, dem „Warum“ von Führung, geht es darum, als Organisation und Führungskraft für Menschen außerhalb des beruflichen Umfelds eine maximale Wirkung zu erzielen. Für die Nachbarschaft, die Gemeinde, für die Gesellschaft insgesamt. Eine systematische, konzertierte Ausrichtung auf alle drei Dimensionen gleichzeitig schaffen gerade mal fünf Prozent der Unternehmen. Und genau das ist der Unterschied zwischen klassischer Unternehmensführung und High-Impact Leadership.
Welche Qualitäten zeichnen High Impact Leaders aus?
Es gibt fünf Kompetenzbündel, die High Impact Leader und ihre Organisationen auszeichnen: Erstens, psychologische Sicherheit. Das heißt, Mitarbeitende können offen ihre Meinung sagen und Fehler zugeben, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Zweitens, Growth Mindset. Diese Leader verstehen Herausforderungen als Lernchancen und wissen, dass Fähigkeiten entwickelbar sind und nicht in Stein gemeißelt. Drittens, Ownership. Sie übernehmen radikale Verantwortung für Ergebnisse und inspirieren andere, das Gleiche zu tun, statt in Ausreden oder Opferrollen zu verfallen. Viertens, Operational Excellence. Solche Leader und Organisationen verbinden die Ziele und Strategien mit konsequenter Umsetzung als Philosophie und Disziplin, um kontinuierlich besser zu werden und gleichzeitig wirkungsvolle Ergebnisse zu realisieren. Und fünftens, Coaching Mindset. Sie entwickeln Menschen durch Empowerment gekoppelt mit Verantwortung statt durch Anweisungen. Sie verstehen Führung als Befähigung und nicht als Kontrolle.
„Führung setzt Richtung und trifft Entscheidungen. Coaching entwickelt die Fähigkeit, selbst Richtung zu setzen und gemeinsam bessere Entscheidungen zu treffen.“
Kann man das lernen?
Absolut. Natürlich gibt es Menschen, die mit bestimmten Voraussetzungen starten, mehr Empathie vielleicht oder natürliche Neugier. Aber diese fünf Dimensionen sind erlernbare Fähigkeiten. Ich habe mit Hunderten von Führungskräften und deren Teams gearbeitet, die sich signifikant weiterentwickelt haben. Der entscheidende Faktor ist nicht Begabung, sondern die Bereitschaft, sich dem ehrlich zu stellen und kontinuierlich wachsen zu wollen, auch wenn es mal wehtut.
Sie betonen – nicht zuletzt in Ihrem Buch – die Kraft einer Coaching-Kultur. Wie etabliert man eine echte Coaching-Kultur?
Um eine echte Coaching-Kultur in einer Organisation aufzubauen und nachhaltig zu verankern, bedarf es sieben Erfolgsfaktoren: Zuerst braucht es ein gemeinsames Verständnis. Man muss klar festlegen, was Coaching ist, wofür es genutzt werden soll und wofür nicht. Ohne diese Klarstellung redet jeder über etwas anderes. In einem zweiten Schritt sollte man die Erwartungen und Ziele von Coaching für die Organisation klären. Man sollte pro Bereich eindeutige, messbare Ziele vereinbaren. Drittens bedarf es eines Projektverantwortlichen, um ein Coaching-Programm im Unternehmen aufzubauen und zu verantworten. Parallel dazu ist ein sichtbarer Sponsor aus dem Topteam genauso wichtig wie der operative Owner, der Coaching- und Changemanagement-Expertise besitzen sollte. Danach definiert man den gewählten Coaching-Ansatz, die einzusetzenden Techniken, den Prozess usw. Im Anschluss sind klare Qualitätsstandards festzulegen. Danach folgt als sechster Erfolgsfaktor die praxisnahe Integration ins Unternehmen. Spezielle und aufeinander abgestimmte Trainings werden aufgesetzt, um in diversen Übungen, Rollenspielen usw. die sofortige Anwendung von Coaching im Alltag zu üben. Letztlich gilt es, den Lerntransfer sicherzustellen mithilfe von Peer-Supervision, Integration in Mitarbeitergespräche, Karriereentwicklungspläne usw. In meinem Buch wird darüber hinaus ein konkreter Rollout-Plan eines Coaching-Programms für jeden Typus von Organisation beschrieben.
Also alle das Buch kaufen! Was unterscheidet Coaching von klassischem Führen?
Führung setzt Richtung und trifft Entscheidungen. Coaching entwickelt die Fähigkeit, selbst Richtung zu setzen und gemeinsam bessere Entscheidungen zu treffen. Der fundamentale Unterschied liegt in der Grundhaltung. Führung arbeitet mit Antworten, Coaching mit Fragen. Eine Führungskraft sagt: „Hier ist das Problem, so lösen wir es.“ Ein Coach fragt: „Was siehst du? Welche Optionen hast du übersehen? Was hindert dich daran konsequent umzusetzen? Was können wir wie besser machen?“
Braucht es nicht beides?
Ja, denn Führung erzeugt zugleich Abhängigkeit, auch wenn sie gut gemeint ist. Jedes Mal, wenn eine Führungskraft eine Lösung liefert, nimmt sie dem Team die Chance, eigene Lösungskompetenz zu entwickeln. Coaching macht das Gegenteil, es baut Unabhängigkeit auf. Dennoch ist klassische, direktivere Führung unverzichtbar, wenn beispielsweise die sprichwörtliche „Hütte brennt“ und schnelle, klare Entscheidungen notwendig sind. Die besten Führungskräfte können zwischen beiden Modi wechseln. Sie erkennen, wann sie konsequent entscheiden müssen und wann sie entwickeln sollten. Viele bleiben allerdings in einem Modus stecken und wundern sich, warum Teams entweder unselbstständig werden oder sich bevormundet fühlen. Ich versuche in meiner Arbeit zu vermitteln, dass Coaching keine weichere Form von Führung ist. Es erfordert andere Skills wie aktives Zuhören, sich als Führungskraft in bestimmten Situationen bewusst zurückzunehmen, Teams zu empowern, das Aushalten von Stille, die Disziplin, keine Lösungen zu liefern, auch wenn man sie hat. Das ist für viele erfahrene Führungskräfte extrem schwierig, weil ihr ganzer Erfolg darauf basierte, Antworten und Lösungen parat zu haben.
„Zu viele Unternehmen behandeln Coaching noch als etwas, das man sich in guten Zeiten gönnt. Das ist fundamental falsch.“
Unternehmen meinen, dass es aktuell dringlichere Themen als die Etablierung einer Coaching-Kultur gibt. Ich vermute mal, dass Sie das anders sehen.
Genau hier liegt das Problem. Zu viele Unternehmen behandeln Coaching noch als etwas, das man sich in guten Zeiten gönnt. Das ist fundamental falsch. In Krisen und schwierigen Zeiten wie jetzt explodiert die Komplexität von Aufgaben und Entscheidungen. Führungskräfte müssen unter extremem Druck mit unvollständiger Information Weichenstellungen treffen, die Jahre nachwirken. Genau dann brauchen sie einen erfahrenen Sparringspartner, der sie auf Augenhöhe begleitet, challengt und hilft, unter Stress nicht in alte Muster oder Nichthandeln zu verfallen. Ein guter Coach unterbricht diese Automatismen genau dann, wenn sie am gefährlichsten sind.
Nach meinem Eindruck sind viele Coaches zurzeit eher unterbeschäftigt.
Möglicherweise. Jedoch nicht jene, die selbst viele Jahre Erfahrung als Top-Führungskräfte in komplexen und dynamischen Umfeldern gemeistert haben und zusätzlich tiefgreifende Coaching-Erfahrung mitbringen. Sie haben bewiesen, dass sie echten Mehrwert sowohl für die Führungskraft als auch deren Organisation schaffen. Wer Coaching als nette Gesprächsrunden verkauft hat, fliegt spätestens jetzt raus. Zu Recht. Gleichzeitig ist es nicht einfach, einen guten Executive Coach zu finden, der nicht schon für Monate im Voraus ausgebucht ist. Es geht im Kern nicht darum, ob man sich Coaching leisten kann. Sondern vielmehr darum, ob man es sich leisten kann, dass Führungskräfte in dieser anspruchsvollen Zeit ohne qualifiziertes Sparring auf höchster Ebene operieren. Die Kosten schlechter Entscheidungen und falschen Weichenstellungen übersteigen jedes Coaching-Budget um ein Vielfaches.
Wo in Ihrer bisherigen Laufbahn haben Sie eine echte Coaching-Kultur vorgefunden?
Eine echte Coaching-Kultur liegt vor, wenn Führung primär durch Befähigung statt durch Anweisung funktioniert. Führungskräfte übertragen dann bedeutsame Verantwortung, klären Erwartungen, greifen nicht unmittelbar ein und führen strukturierte Reflexionsgespräche, die Menschen befähigen, selbst Lösungen zu entwickeln. Eine solche Organisation gibt es idealtypisch nur sehr selten, allenfalls in Teilbereichen. Was ich erlebt habe ist, dass einzelne Führungskräfte, die dieses Prinzip konsequent leben, während der Rest der Organisation klassisch steuert und kontrolliert. Coaching-Kultur entsteht nur, wenn individuelle Führungshaltung und organisationale Rahmenbedingungen zusammenkommen. Ein Leader kann in seinem Bereich coachend führen, aber ohne entsprechende Strukturen, Zeitbudgets und Anreizsysteme bleibt das fragil und nicht skalierbar. Mitarbeitende erleben je nach Führungskraft völlig unterschiedliche Realitäten in derselben Organisation. Manche wachsen exponentiell, andere verkümmern sprichwörtlich, abhängig davon, an wen sie berichten und welche Strukturen dahinterstehen.
„Starke Führung schafft Orientierung in Komplexität, fordert Leistung und Verantwortung, bleibt aber immer menschlich. Sie verbindet harte Ergebnisorientierung mit echtem Interesse an Menschen.“
Ist Ihr Buch das Ergebnis positiver Beobachtungen und eigener Erfahrungen? Oder mehr eine Reaktion und Empfehlung, wie man es anders machen sollte?
Das Buch ist die Summe mehrjähriger Forschungsarbeit, inklusive neuester Erkenntnisse zu Leadership und Coaching, sowie meiner Doktorarbeit, kombiniert mit fast 30 Jahren Arbeit in Unternehmen und der Zusammenarbeit mit Hunderten von Führungskräften in den letzten 20 Jahren. Es ist gewissermaßen das Destillat all dieser Arbeit und somit weder Theorie noch bloße Praxisanekdoten, sondern die Verdichtung dessen, was nachweislich funktioniert, wissenschaftlich fundiert ist und sich in unterschiedlichsten Organisationen, Industrien und Ländern bewährt hat.
Sie haben für traditionsreiche deutsche Einzelhändler wie Tchibo und Rewe gearbeitet und für global player wie L’Oreal und Amazon. Welches dieser Unternehmen kommt von der Führungskultur und der Führungspraxis Ihrem Idealbild am nächsten?
Ich habe neben meiner Zeit bei L’Oréal, Amazon, Rewe und Tchibo auch direkt für andere Unternehmen gearbeitet und als Executive Coach und Berater mit vielen weiteren Organisationen verschiedenster Branchen und Kulturen zusammengearbeitet. Von der Uhrenmanufaktur in der Schweiz bis hin zum Raumfahrtunternehmen in den USA. Name Dropping würde dem nicht gerecht werden und wäre auch nicht zielführend.
Schade. Das hätte uns interessiert.
Entscheidend ist, was starke Führung wirklich ausmacht. Sie schafft Orientierung in Komplexität, fordert Leistung und Verantwortung, bleibt aber immer menschlich. Sie verbindet harte Ergebnisorientierung mit echtem Interesse an Menschen. Sie verlangt Exzellenz, Disziplin und Mut. Und weiß zugleich, dass eine gesunde und nachhaltige Führungskultur nur entsteht, wenn Menschen Vertrauen spüren, mitreden können und sich entwickeln dürfen. Diese Form von Führung ist kein Stil, sondern eine Haltung. Sie zeigt sich dort, wo Leader Klarheit schaffen, Verantwortung leben und Ergebnis- und Menschorientierung konsequent in Einklang bringen. Unabhängig davon, welches Unternehmen auf der Visitenkarte steht.
Dr. Andreas von der Heydt ist Executive Coach, Berater und Leadership Experte. Seine Schwerpunkte liegen in High-Impact Leadership, Transformationsmanagement und im Aufbau organisationsweiter Coaching-Programme. Auf Basis einer 25-jährigen internationalen Karriere als Geschäftsführer und Vorstand in führenden Unternehmen wie L’Oreal, Amazon und Tchibo sowie 20 Jahren Erfahrung als interner und externer Coach begleitet er Top-Führungskräfte im In- und Ausland. Andreas ist Senior Lecturer für Leadership & Coaching an der European Business School (EBS), Autor mehrerer Bücher zu Leadership und Coaching sowie ein gefragter Keynote Speaker zu zukunftsweisenden Führungsthemen.